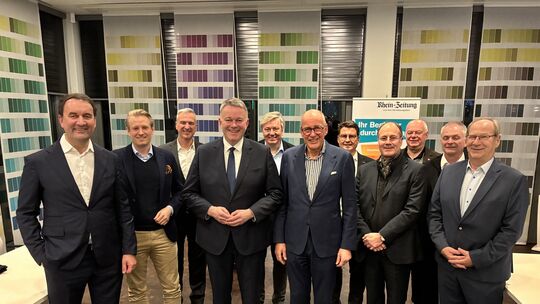Innerkirchliche Kritik an Limburger Bischof

Szene bei der 1100-Jahr-Feier auf dem Platz vor dem Limburger Dom: Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst lässt sich einen blitzenden Oldtimer erklären.
Dieter Fluck
Lesezeit 4 Minuten

Szene bei der 1100-Jahr-Feier auf dem Platz vor dem Limburger Dom: Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst lässt sich einen blitzenden Oldtimer erklären.
Dieter Fluck