Edelminimalismus fürs Eigenheim: Schauspiel Frankfurt ehrt Arthur Miller
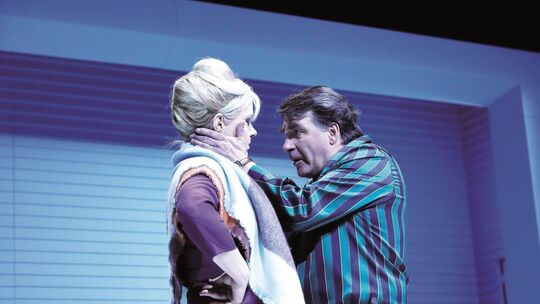
Besticht mit Vielschichtigkeit: Katharina Linder verleiht Arthur Millers Oberflächenarrangement „Alle meine Söhne“ Tiefe.
Hans Jürgen Landes
Lesezeit 3 Minuten
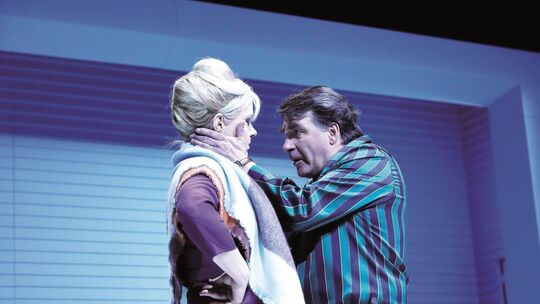
Besticht mit Vielschichtigkeit: Katharina Linder verleiht Arthur Millers Oberflächenarrangement „Alle meine Söhne“ Tiefe.
Hans Jürgen Landes